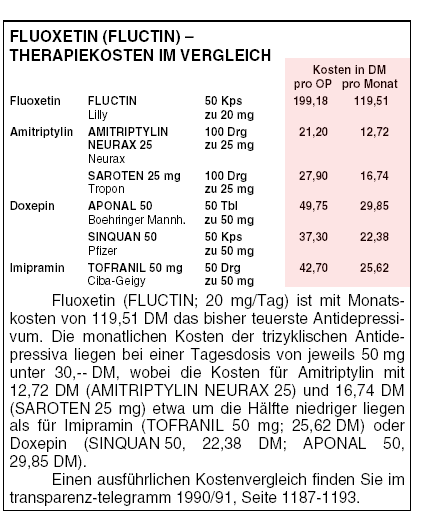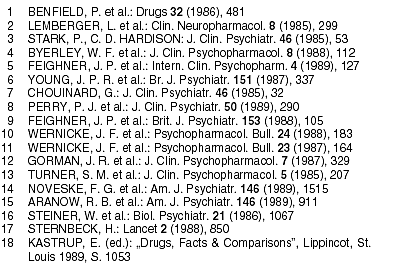Zur Behandlung von Depressionen dienen chemisch heterogene Substanzen, deren Wirkprinzip überwiegend auf der Erhöhung der
Monaminkonzentration in den synaptischen Spalts der Nervenendigungen im ZNS beruht. Ob allein dadurch die Wirkung der Mittel erklärbar ist oder ob
modulierende Einflüsse auf Monaminrezeptoren oder "Postrezeptoreneffekte" den eigentlichen Wirkmechanismus darstellen, ist offen. Antidepressiva
führen entweder durch Hemmung des Abbaus (MAO-Hemmer) oder der Wiederaufnahme in die präsynaptischen Nervenendigungen (trizyklische und
andere Antidepressiva) zu einer Konzentrationszunahme der Monamine. Wiederaufnahmehemmer haben eine unterschiedliche Spezifität für einzelne
Monamine (Dopamin, Serotonin, Noradrenalin), ohne daß sich daraus eine Spezifität hinsichtlich der Indikation ableiten läßt. Überwiegend
hemmen sie die Noradrenalin-Wiederaufnahme, einige schwächer auch die von Serotonin.
Seit April des Jahres ist Fluoxetin (FLUCTIN) erhältlich. Die Markteinführung war begleitet von kritiklosen redaktionellen Beiträgen in den
Laienmedien: "Nie mehr traurig", "Psychodrops" (Esquire), "Ich nahm die Glückspille. Der Himmel hat sie mir geschenkt"
(Bunte).
WIRKUNGEN: Das bizyklische Fluoxetin hemmt vor allem die neurale Wiederaufnahme von Serotonin in die präsynaptischen Nervenendigungen. In
vitro ist dieser Effekt deutlicher als bei Zimelidin (NORMUD, außer Handel) und vergleichbar mit der von Fluvoxamin (FEVARIN) und Clomipramin (ANAFRANIL),
in vivo dagegen 7mal, 25mal bzw. 40mal stärker ausgeprägt. Die Wiederaufnahme von Noradrenalin und Dopamin wird in vivo nicht beeinflußt.
Obwohl die Serotonin-Wiederaufnahme prompt gehemmt wird, sind antidepressive Effekte erst mit einer Latenz von Wochen nachweisbar. Fluoxetin hat keine
Affinität zu Alpha- oder Beta-Rezeptoren oder zu Azetylcholin-, Serotonin-, Histamin-, Dopamin- und GABA-Rezeptoren. Eine "Down-Regulation" von
Beta-Rezeptoren, ein möglicher Wirkmechanismus von trizyklischen Antidepressiva, tritt nicht auf, wahrscheinlich aber von Serotonin-Rezeptoren.
Analgetische und hypotherme Wirkungen von Fluoxetin sind im Tierversuch nachgewiesen, klinisch aber wohl ohne Bedeutung. Die REM-Schlafdauer wird
dosisabhängig vermindert. Ohne Toleranzentwicklung kommt es zu einer reversiblen Gewichtsabnahme. Die Plasmaspiegel der hypophysären Hormone
FSH, LH, STH und Prolactin bleiben unbeeinflußt. Wahrscheinlich über eine Zunahme der Corticotropin-Releasing-Factor-Spiegel im hypophysären
Portalvenensystem steigt der Plasma-Kortisolspiegel an. Bis auf eine diskrete Abnahme der Herzfrequenz hat Fluoxetin keine auffällige Wirkung auf Herz und
Kreislauf, allerdings bewirkte die gleichzeitige Verwendung von Tryptophan (KALMA u.a., außer Handel) eine Blutdrucksenkung.1,2 Wiederholt werden
unter Fluoxetin Appetitminderung und signifikante Gewichtsabnahme beobachtet.6,8
EIGENSCHAFTEN: Fluoxetin wird unabhängig von der Nahrungsaufnahme gut resorbiert, die Bioverfügbarkeit beträgt 72%.
Plasmaspitzenkonzentrationen finden sich nach 6-8 Stunden. Bei Langzeittherapie erreichen die Plasmaspiegel erst nach 2-4 Wochen den "Steady
State". Ca. 94% von Fluoxetin sind an Plasmaeiweiß gebunden, ein Verteilungsvolumen von 20-40 l/kg spiegelt die ausgeprägte Gewebebindung
wider.
Fluoxetin wird in der Leber ausgiebig metabolisiert, wobei ein Großteil der Metabolite bisher chemisch nicht definiert werden konnte. Wichtigster Metabolit ist
Desmethyl-Fluoxetin, das ebenfalls die Serotonin-Wiederaufnahme spezifisch hemmt. Nach Gabe von radioaktiv markiertem Fluoxetin erscheinen 60% der
Aktivität im Urin, 16% im Stuhl. Die Eliminations-Halbwertszeit von Fluoxetin beträgt 1-4 Tage, von Desmethyl-Fluoxetin ca. 7 Tage.
Im Alter oder bei eingeschränkter Nierenfunktion soll die Eliminations-Halbwertszeit nicht verlängert sein, bei Leberfunktionsstörungen wird dagegen
eine Dosisreduktion notwendig. Daten über Dialysierbarkeit, Übertritt in die Muttermilch oder in den fetalen Kreislauf liegen nicht vor.1
WIRKSAMKEIT: Die Wirksamkeit von Fluoxetin wurde hauptsächlich an ambulanten Patienten mit mittelschwerer Symptomatik einer unipolaren
endogenen Depression untersucht. Die kontrollierten Studien liefen in der Regel über 6 Wochen, die Wirksamkeit wurde anhand von Scores
überprüft (Hamilton Rating Scale, Raskin Depression Scale, Covi Anxiety Scale, Clinical Global Impression). Eine Besserung der depressiven Symptomatik
fand sich recht einheitlich wie bei den klassischen trizyklischen Antidepressiva bei ca. 70% der Patienten. Bemerkenswert ist, daß 30-50% der antidepressiv
behandelten Personen und bis zu 60% der Patienten unter Plazebo die Studien wegen fehlender Wirkung oder Störwirkungen vorzeitig beendeten.
Gegenüber Imipramin (TOFRANIL) beeinflußt Fluoxetin in mehreren Studien etwa gleich gut die globale depressive Symptomatik; im Gegensatz zu
Imipramin werden jedoch Einzelkriterien wie Schlafstörungen oder Angstsymptome nicht immer besser als durch Plazebo beeinflußt.3,4 Eine
signifikante Wirkung von Imipramin ließ sich gegenüber Plazebo schon nach 2 Wochen nachweisen, von Fluoxetin erst nach 6 Wochen. In der globalen
Wirksamkeit unterscheiden sich beide Medikamente nicht, jedoch weist Imipramin tendenziell Vorteile auf und bessert im Gegensatz zu Fluoxetin
Schlafstörungen.5
Amitriptylin (SAROTEN u.a.; 50-200 mg) besitzt bei gleicher Besserung der globalen Symptomatik ebenfalls Vorteile bei Einzelkriterien gegenüber 40-80
mg Fluoxetin.6 Nachteile von Fluoxetin bestehen auch hier bei der Beeinflussung von Schlafstörungen.7
Gegenüber Doxepin (APONAL, SINQUAN; durchschnittlich 230 mg) bessert Fluoxetin (durchschnittlich 70 mg) depressive Symptome und
Angstsymptomatik etwa gleich gut. Die Wirkung setzt langsamer ein als bei Doxepin.1
Verglichen mit Trazodon (THOMBRAN; 50-400 mg) werden Hamilton Rating Scale und Clinical Global Impression durch 20-60 mg Fluoxetin nach 3 Wochen
weniger gut beeinflußt. Nach 6 Wochen besteht kein Wirksamkeitsunterschied mehr.8 Auch bei älteren Patienten (über 60 Jahre) wirken 20
-80 mg Fluoxetin gleich gut wie trizyklische Antidepressiva (Doxepin, Imipramin, Amitriptylin mit 50-300 mg). Durch die geringere Inzidenz anticholinerger
Störwirkungen sind in der Fluoxetin-Gruppe Therapieabbrüche seltener (32/136 vs. 45/131).9
Über positive Effekte bei Erkrankungen mit Panikreaktionen und Zwangssymptomatik wurde bisher nur in unkontrollierten Studien an kleinen Patientenzahlen
berichtet.12,13 Langzeiteffekte von Fluoxetin bei Kranken mit endogener Depression sind nur in einer offenen Studie untersucht, wobei sich gleiche
Rezidivraten und Zeiten bis zum Rezidiv wie bei Imipramin ergaben.1
DOSIS: Fluoxetin wurde in einem weiten Dosisbereich getestet: Täglich 5 mg*, 20 mg und 40 mg wirken nach 2-5 Wochen gleich gut. 60 mg pro Tag
sind nicht wirkstärker, führen jedoch signifikant häufiger zu Therapieabbrüchen.10,11 Dosen über 40 mg/Tag sind nicht
begründbar.
* FLUCTIN-Kapseln mit 20 mg Wirkstoff sind nicht teilbar.
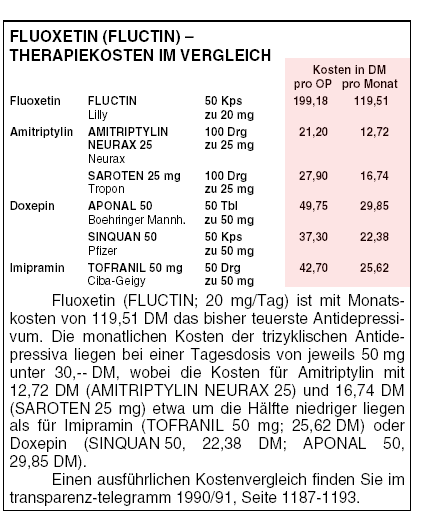
UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN: Diese spiegeln die stimulierenden Wirkungen von Fluoxetin wider. Am häufigsten sind mit 10-25%
Übelkeit (25%), Erbrechen, Nervosität, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Tremor, Angst, Schwindel, Schwitzen und Durchfall (10%), die an ein
"Serotonin-Syndrom" erinnern und in 2-4% zum Therapieabbruch führen. Die Auslösung von Panikreaktionen, manischen Phasen und
psychotischen Reaktionen (ca. 1%) ist beschrieben, vereinzelt auch die von zerebralen Krampfanfällen, extrapyramidal-motorischen Störungen sowie von
suizidalen Tendenzen.18,19,21
Anticholinerge Störwirkungen treten seltener als unter trizyklischen Antidepressiva auf: Mundtrockenheit (10%), Obstipation (5%), Sehstörungen (3%) sowie
Hypotonie, Palpitationen, Miktionsstörungen und gestörte Sexualfunktion (je 1%). Im Gegensatz zu trizyklischen Antidepressiva mindert Fluoxetin den
Appetit (10%) und führt zur Gewichtsabnahme. An kardialen Störungen ist lediglich eine diskrete Abnahme der Herzfrequenz beschrieben, auch im
Rahmen von Intoxikationen traten nur unspezifische EKG-Veränderungen ohne Blockbilder oder Arrhythmien auf. Unerwünschte Wirkungen an Nieren
und Blutbildungssystem wurden bisher nicht beschrieben, eine Phospholipoidose an Retina und Lungen bisher nur in Tierversuchen.
Häufigste ernsthafte Störwirkungen sind immunallergische Reaktionen, meist in Form von makulösen, papulösen oder urtikariellen Exanthemen
(bis 3%). Sie können mit Arthralgien, Fieber, Leukozytose und Gelenkschwellungen einhergehen. Vereinzelt wird auch über Serumkrankheit berichtet.
Grippeähnliche Bilder, die als Ausdruck schwerer Immunreaktionen in 10% unter dem ebenfalls spezifischen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Zimelidin
auftraten, werden unter Fluoxetin bei bis zu 2,8% beschrieben.18,19
Solche immunallergischen grippeähnlichen Syndrome müssen kritisch gewertet werden, da sie häufig Erstsymptome einer immuntoxischen
Organmanifestation sind. Bei Zimelidin fanden sich gehäuft nach dem Erstsymptom Thrombozytopenien und allergische Neuritiden, die zur
Marktrücknahme führten. Bei Nomifensin (ALIVAL) folgten dem Erstsymptom Vaskulitiden, hämolytische Anämien und variable
Organschäden, die ebenfalls die Marktrücknahme bedingten. Auch aufgrund des in letzter Zeit häufiger beobachteten Eosinophilie-Myalgie-
Syndroms ist Vorsicht geboten bei Substanzen, die in den Serotonin-Stoffwechsel eingreifen. Als chronisch-entzündliche Erkrankung von Haut und
Muskelfaszien, teils mit einer generalisierten Vaskulitis, wird das EMS durch die Serotonin-Vorstufe Tryptophan ausgelöst und beruht möglicherweise auf
einem veränderten Serotonin-Metabolismus. Einige der Patienten mit diesem Syndrom nahmen neben Tryptophan gleichzeitig Fluoxetin.20
Erfahrungen für die Anwendung in der Schwangerschaft fehlen. Tierexperimentell sind keine teratogenen Effekte nachgewiesen. Es wurde über
Intoxikationen mit maximal 3000 mg berichtet, die mit zerebralen Krampfanfällen, Übelkeit, Erbrechen, Agitationen, Manie, Schlaflosigkeit und Tremor
einhergingen. Unter 38 Berichten finden sich 2 Todesfälle.
INTERAKTIONEN: Fluoxetin hemmt die Metabolisierung von Hexobarbital und Ethinamat. Höhere Dosen verlängern die Halbwertszeit von
Diazepam (VALIUM u.a.). In Kombination mit Lithium ist kasuistisch eine Enzephalopathie beschrieben.14 Wahrscheinlich durch Hemmung der
Metabolisierung kann Fluoxetin die Plasmaspiegel gleichzeitig gegebener trizyklischer Antidepressiva deutlich erhöhen mit der Gefahr vermehrter
Störwirkungen.15 Bei Kombination mit L-Tryptophan kam es wiederholt zu toxischen Reaktionen mit Tremor, Herzklopfen, Kopfschmerzen, Agitation,
Übelkeit und Unruhe.16 Über schwere, toxische Reaktionen – ebenfalls im Sinne eines "Serotonin-Syndroms", z.T. mit
Todesfolge – wurde im Zusammenhang mit MAO-Hemmern berichtet. MAO-Hemmer sollten frühestens 5 Wochen nach einer Fluoxetin-Therapie gegeben
werden.17
FAZIT: Fluoxetin (FLUCTIN) ist ein bizyklisches Antidepressivum mit langer Wirkdauer und pharmakologisch aktiven Metaboliten. Es wirkt gleich gut wie
klassische Trizyklika (Imipramin [TOFRANIL], Amitriptylin [SAROTEN u.a.], Doxepin [APONAL, SINQUAN]). Der Wirkungseintritt ist jedoch verzögert.
Schlafstörungen werden nicht und Angstsymptomatik weniger gut beeinflußt.
Anticholinerge Störwirkungen sind geringer ausgeprägt als bei trizyklischen Antidepressiva, dagegen finden sich häufiger zentral-stimulierende Effekte
im Sinne eines Serotonin-Syndroms. Ebenfalls häufiger treten teils schwerwiegende immunologische Störungen wie Exantheme, grippeähnliche Bilder
und Arthralgien auf, die von dem deshalb vom Markt genommenen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Zimelidin (NORMUD) bekannt sind. Auch wegen des
möglicherweise durch einen geänderten Serotonin-Abbau verursachten Eosinophilie-Myalgie-Syndroms erscheint Vorsicht angebracht. Aufgrund des eher
ungünstigen Wirkungsprofils und der potentiell gefährlicheren Störwirkungen beurteilen wir das Nutzen/Risiko-Verhältnis gegenüber den
klassischen trizyklischen Antidepressiva negativ.
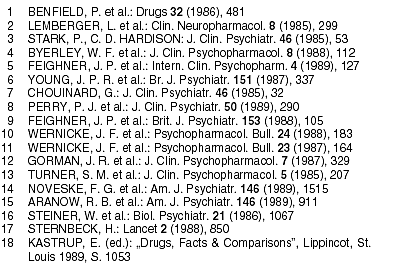
|