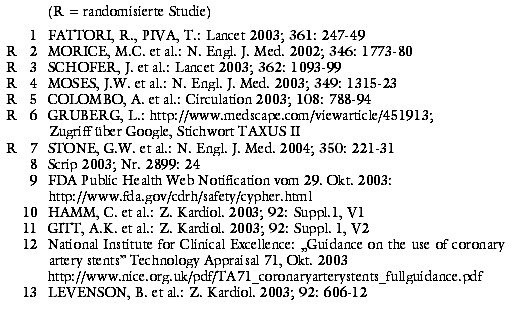Bei perkutanen Koronareingriffen bedeuten Restenosen das größte Langzeitproblem. Sie treten nach Stenteinlage in 15% bis 60% auf. Meist
handelt es sich um Stenosen innerhalb des Stents infolge Proliferation von Neointima und glatten Gefäßmuskelzellen. An der Pathogenese sind
ähnlich wie bei entzündlichen oder tumorösen Prozessen Zytokine beteiligt. Zytostatische und immunsuppressive Substanzen können diese
proliferativen Vorgänge hemmen. Um lokal hohe Konzentrationen bei geringer systemischer Belastung zu erreichen, wurden arzneimittelbeschichtete Stents
entwickelt, die die Wirkstoffe aus Depots an der Oberfläche verzögert freisetzen.1
Seit 2002 ist in Deutschland ein mit Sirolimus (CYPHER) und seit 2003 ein mit Paclitaxel (TAXUS) beschichteter Stent verfügbar. Die eingelagerten Wirkstoffe
werden etwa 30 Tage lang aus einem Polymer abgegeben. In klinischer Prüfung, aber nicht zugelassen, sind mit Paclitaxel beschichtete Stents, die nicht auf
Polymer-Basis beruhen. Systemisch wird Sirolimus (RAPAMUNE) als Immunsuppressivum zur Prophylaxe von Abstoßungen nach Nierentransplantation
verwendet, der Mitosehemmstoff Paclitaxel (TAXOL) als Zytostatikum für verschiedene Tumorarten.
Sirolimus-beschichtete Stents werden in drei größeren randomisierten, doppelblinden Studien mit insgesamt mehr als 1.600 Patienten mit
unbeschichteten Stents verglichen.2-4 Indikation für die koronaren Stents bei den im Mittel 60- bis 62-jährigen Patienten sind mittel- bis
langstreckige nicht vorbehandelte ("de-novo"-) Stenosen in Koronarien mit kleinem Durchmesser. Klinisch liegt eine instabile Angina (33% bis 53%) oder
eine chronisch-stabile koronare Herzkrankheit vor. Akute Infarkte gelten als Ausschlussgrund. Vor und nach dem Eingriff erhalten alle Patienten
Azetylsalizylsäure (ASPIRIN u.a.) und Clopidogrel (ISCOVER, PLAVIX). Die Anwendung eines Glykoprotein IIb/IIIa-Blockers ist den jeweiligen Zentren
freigestellt.
Der innerhalb von sechs bis neun Monaten nach Implantation auftretende Lumenverlust der behandelten Stenosen ist bei Verwendung Sirolimus-beschichteter
Stents 0,7-0,9 mm geringer als bei Einlage herkömmlicher Stents. Die Rate der mehr als 50%igen Restenosierungen sinkt von 27% bis 42% auf 0% bis 6%. Der
klinische Nutzen beschränkt sich in allen Arbeiten auf die seltenere Notwendigkeit einer Revaskularisation der Zielstenosen (1% bis 4% vs. 17% bis 24%).
Infarktrate und Mortalität werden hingegen nicht beeinflusst.
Für die auf Polymerbasis mit Paclitaxel beschichteten Stents liegen zwei größere randomisierte, doppelblinde Vergleiche mit unbeschichteten
Stents bei 536 bzw. 1.314 Patienten mit instabiler Angina (jeweils 34%) oder chronisch-stabiler koronarer Herzerkrankung vor.5-7 Die Vorgaben für die
Begleitbehandlung entsprechen weitgehend denen der Studien mit Sirolimus-Stents.
Nach sechs bzw. neun Monaten werden Restenosen signifikant verringert (3,5% bzw. 8% vs. 19% bzw. 27%). Revaskularisationen sind seltener notwendig (4% bis
5% vs. 12% bis 14%). Sterblichkeit und Herzinfarktrate bleiben wie bei den Sirolimus-Stents unbeeinflusst.
Die Langzeiteffekte beschichteter Stents sind nicht ausreichend geklärt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Restenosen nicht verhindert, sondern nur
zeitlich verzögert werden. Sicherheitsdaten über mehr als zwölf Monate liegen kaum vor. Innerhalb von sechs Monaten nach Markteinführung
des CYPHER-Stents in den USA sind bei der FDA bereits mehr als 290 Berichte über subakute Stentthrombosen (ein bis 30 Tage nach Implantation)
eingegangen, 60 mit tödlichem Ausgang.8 Die FDA geht von einer hohen Dunkelziffer aus.9 Mehr als 50 weitere Meldungen an die FDA
betreffen Hypersensitivitätsreaktionen. Die FDA rät dringend, die Stents nur bei den Patienten und mit solchen Techniken einzusetzen, für die Daten
aus klinischen Studien vorliegen. In Deutschland werden beschichtete Stents dagegen vorwiegend beim akuten Koronarsyndrom, Mehrgefäßerkrankung
und bei Restenosen verwendet10,11 - Indikationen, für die bisher keine Nutzenbelege aus Studien vorliegen.
Die drei- bis fünffach höheren Kosten für beschichtete Stents werden von den gesetzlichen Krankenkassen bisher in der Regel nicht
übernommen. Gemäß Studienlage müssen 4 bis 8 CYPHER-Stents bzw. 10 bis 14 TAXUS-Stents statt der herkömmlichen eingesetzt
werden, um eine Restenose zu verhindern. Der Nutzen der Stents dürfte damit aber überschätzt sein, da die Kontrollangiografien in den Studien
systematisch und nicht symptomorientiert vorgenommen werden.
Das britische NICE* empfiehlt unter Kosten/Nutzen-Aspekten den Gebrauch von beschichteten Stents bei symptomatischer koronarer Herzkrankheit nur dann, wenn
das Zielgefäß kleiner als 3 mm im Durchmesser und die Stenose länger als 15 mm ist.12 Diabetes stellt per se keine Indikation dar, ist aber
häufiger mit solchen Gefäßverhältnissen assoziiert. Im Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie wird die Indikation
für beschichtete Stents jenseits der vorhandenen Evidenz wesentlich großzügiger gestellt, ohne dass hierfür eine Begründung gegeben
wird.13
Die zugelassenen, mit Sirolimus (CYPHER) oder Paclitaxel (TAXUS) beschichteten Stents reduzieren mittelfristig die Häufigkeit koronarer Restenosen und
die Notwendigkeit einer erneuten Revaskularisation im Vergleich mit unbeschichteten Stents. Mortalität und Infarktrate bleiben jedoch unbeeinflusst.
Subakute Stentthrombosen und schwere Hypersensitivitätsreaktionen scheinen nach Postmarketingerfahrungen häufiger aufzutreten als auf Grund der
klinischen Prüfung zu erwarten wäre.
Langzeitnutzen und -sicherheit sind nicht belegt.
Langzeitstudien und Kosten/Nutzen-Analysen sind dringend erforderlich.
Zurzeit kann ein Einsatz nur bei langstreckigen "de-novo"-Stenosen in kleinkalibrigen Gefäßen erwogen werden.

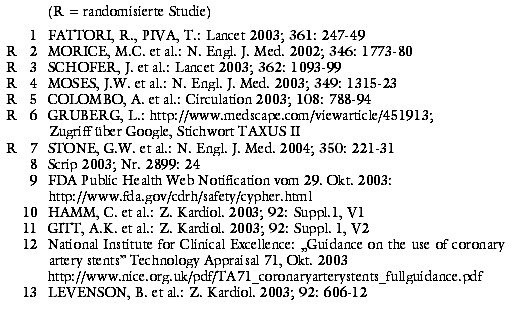
|