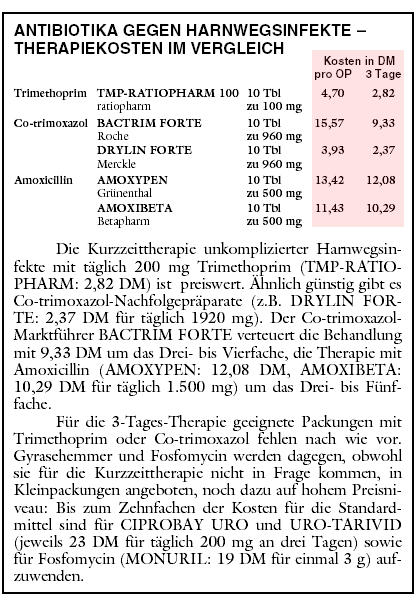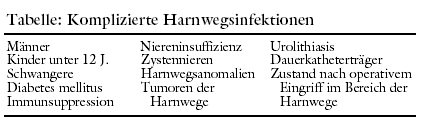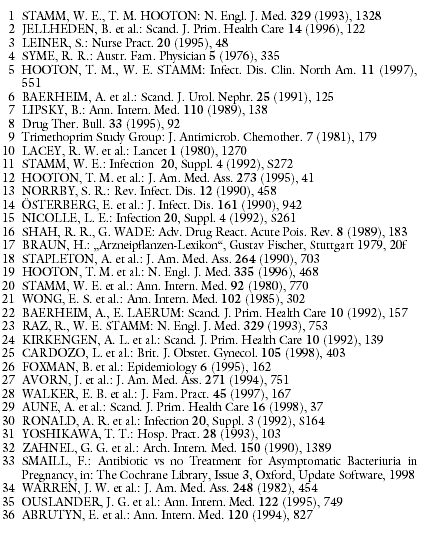Knapp 4% der Patienten einer Allgemeinpraxis kommen mit Harnwegsbeschwerden zu ihrem Arzt. Vor allem Frauen sind betroffen. 80% bis 90% der
ambulant erworbenen unkomplizierten Harnwegsinfekte lassen sich auf E. coli zurückführen, bis zu 15% auf Staphylococcus saprophyticus, seltener auf
andere Enterobakterien.1,2 Die Prognose des unkomplizierten Infekts ist gut. Nierenschäden sind nicht zu befürchten.3,4 Die
Behandlung dient vor allem der Symptomkontrolle.
Alle Harnwegsinfekte bei Schwangeren, Kindern unter zwölf Jahren, bei Harnwegsanomalien oder chronischen Erkrankungen wie Diabetes mellitus gelten als
kompliziert. E. coli kommt hier mit 20% bis 50% seltener vor, Problemkeime wie Pseudomonas häufiger. Da sonst gesunde, junge Männer ausgesprochen
selten betroffen sind,5 empfiehlt es sich, auch Infekte bei Männern grundsätzlich als kompliziert anzusehen (siehe Tabelle).
DIAGNOSTIK: Häufiger, oft imperativer Harndrang und Schmerzen beim Wasserlassen prägen das klinische Bild. In der Regel treten die
Symptome plötzlich aus voller Gesundheit heraus auf. Abzugrenzen ist die Nierenbeckenentzündung, die meist mit Fieber, (Klopf-) Schmerz des
Nierenlagers und allgemeinem Krankheitsgefühl einhergeht. Bei Kleinkindern oder alten Patienten kommen aber auch symptomarme oder symptomlose
Pyelonephritiden vor.
Untersuchung des Urins sichert die Diagnose. Beim einfachen Harnwegsinfekt reicht der Streifentest auf Nitrit und Leukozyten (Sensitivität bei
klinischem Verdacht auf Infekt: 93%).2 Frauen sollen die Labien spreizen,6 unbeschnittene Männer die Vorhaut zurückziehen, um eine
Kontamination der Probe zu vermeiden. Mittelstrahlurin wird entgegen häufiger Empfehlung nicht benötigt.7 In Zweifelsfällen, bei
Therapieversagen, Verdacht auf Pyelonephrititis und bei allen komplizierten Harnwegsinfekten wird eine Kultur angelegt.
Differentialdiagnostisch sind Entzündungen der Scheide und Infektionen der Harnröhre durch Chlamydien, Gonokokken oder Herpes-simplex-
Viren in Erwägung zu ziehen. Fallen bei jungen Frauen mit dysurischen Beschwerden Streifentest und Kultur negativ aus, ist gezielt nach einer
Chlamydieninfektion zu fahnden. Die häufig asymptomatisch verlaufenden Infekte können durch Entzündungen der Eileiter Sterilität
verursachen. Die in ihrer Pathogenese ungeklärte sogenannte Reizblase ist eine Ausschlussdiagnose. Bei Männern kommen auch akute oder chronische
Prostatitis als Ursache für die Beschwerden in Betracht.
Weiterführende Untersuchungen sind nur bei Verdacht auf Nierensteine, Tumoren oder die seltenen funktionell/anatomischen Veränderungen
der Harnwege erforderlich. Auch rezidivierende Infekte jüngerer Frauen bedeuten keine Indikation für routinemäßige zusätzliche
Diagnostik. Uterussenkung mit Blasenvorfall und Restharn begünstigen Infektionen. Bei älteren Frauen empfiehlt sich die gynäkologische
Abklärung.1
Männer mit einem (ersten) Infektrezidiv sind in Kooperation mit einem Urologen zu betreuen, ebenso alle Patienten mit Harnwegsinfekt bei Urolithiasis
oder wiederkehrender Pyelonephritis. Kinder unter 12 Jahren sollen wegen der Gefahr bedrohlicher Nierenparenchymschäden bereits beim ersten Infekt
urologisch untersucht werden. Oft liegen anatomische oder funktionelle Anomalien wie vesikoureteraler Reflux zugrunde, bei Jungen auch häufig
Phimosen.
Eine Kontrolluntersuchung nach klinisch erfolgreicher Therapie ist nur bei Schwangeren erforderlich.
UNKOMPLIZIERTE HARNWEGSINFEKTE: Medikament der Wahl ist Trimethoprim (TMP-RATIOPHARM). Die Fixkombination mit
Sulfamethoxazol (Co-trimoxazol [EUSAPRIM u.a.]) wirkt nicht besser. Das Risiko unerwünschter Wirkungen ist dagegen höher, so etwa von
Allergien durch den Sulfonamidanteil.8-10
Für Frauen unter 65 Jahren empfiehlt sich die Kurzzeittherapie.11,12 Zweimal täglich 100 mg Trimethoprim über drei Tage wirken
mit Heilungsraten von über 90% ähnlich gut wie eine längere Behandlung oder wie drei Tage lang zweimal täglich 960 mg Co-trimoxazol.
Verglichen mit einwöchiger Therapie ist die Compliance besser, unerwünschte Wirkungen sind seltener, und die körpereigene Bakterienflora wird
weniger beeinträchtigt.1,13 Zwar spricht der Infekt bereits auf eine Einzeldosis von 320 mg Trimethoprim an, die vollständige Beseitigung der
Bakterien gelingt jedoch mit längerer Therapie besser (94% vs. 82%). Rezidive sind seltener (13% vs. 29% nach fünf Wochen).14 Für die
Kurzzeittherapie geeignete Kleinpackungen mit Trimethoprim oder Co-trimoxazol fehlen hierzulande. In der Schweiz gibt es Packungen mit 3 Tabletten zu 960 mg
Co-trimoxazol (z. B. COTRIM, NOPIL).
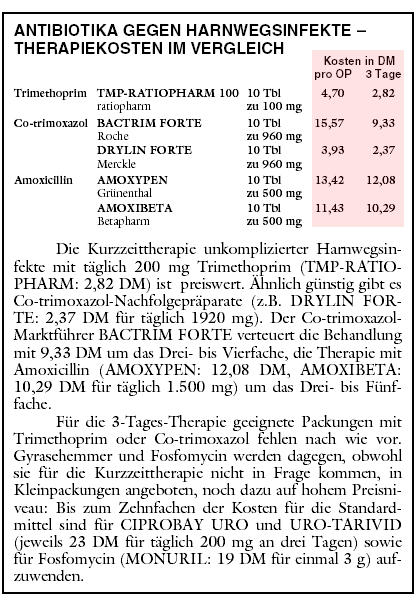
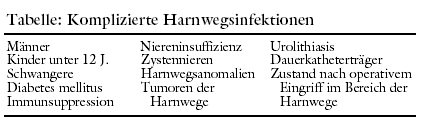
Ältere Frauen, die in Heimen leben oder eingeschränkt beweglich sind, werden sieben Tage lang behandelt. Kurzzeittherapien sind hier wenig
erprobt und komplizierende Faktoren wie Restharn oder schlechte Abwehrlage häufig.15
Alternativ kommt Amoxicillin (AMOXYPEN u.a.) in Betracht. Zwar sind hierzulande etwa 15% der E-coli-Stämme gegen das Aminopenizillin resistent. Im
Urin wird aber ein Vielfaches der minimalen Hemmkonzentration erreicht. Angesichts der Gutartigkeit der Infektion erscheint uns daher die Anwendung bei
Unverträglichkeit von Trimethoprim vertretbar. In einer aktuellen Studie schneidet die Kurzzeittherapie mit täglich 1.500 mg Amoxicillin nicht signifikant
schlechter ab als die mit Co-trimoxazol.12 Ähnliches gilt für ein Cephalosporin der ersten Generation wie Cefaclor (PANORAL u.a.), das
jedoch deutlich teurer ist.
Gyrasehemmer werden als Reserve-Antibiotika für schwere Erkrankungen benötigt. Unkritische Anwendung fördert Resistenzen (a-t 2 [1994], 19). Die Kurzzeittherapie unkomplizierter Harnwegsinfekte mit Gyrasehemmern erachten wir als irrational.
Auch wegen der hohen Rate zentralnervöser Störungen, besonders bei Älteren, und der hohen Kosten (siehe Kasten) empfiehlt sich
Zurückhaltung. Die Mittel versagen häufig bei Staphylococcus-saprophyticus-Infektionen. In der Schwangerschaft und bei Kindern sind sie
kontraindiziert.
Das mit keinem anderen Antibiotikum verwandte Fosfomycin dient als i.v.-Zubereitung (FOSFOCIN) der Therapie systemischer Gram-positiver Infektionen
bei Unwirksamkeit oder Unverträglichkeit von Erstwahlmitteln. Resistenzen gegen Fosfomycin entwickeln sich sehr rasch. Die auch von der PAUL-EHRLICH-
Gesellschaft angepriesene Eindosisbehandlung per os (MONURIL) bei unkomplizierten Harnwegsinfekten verbietet sich daher.
Da verträglichere, wirksame Arzneimittel verfügbar sind, wird das mit zwar seltenen, aber schweren Störwirkungen wie Polyneuropathie, Pneumonitis
und Hepatitis16 belastete Nitrofurantoin (FURADANTIN u.a.) für den unkomplizierten Harnwegsinfekt nicht mehr gebraucht (a-t 11 [1993], 128).
Für in Deutschland beliebte pflanzliche Medikamente wie Bärentraubenblätterextrakt (UVALYSAT BÜRGER u.a.) und Tees
wie HARNTEE 400 fehlen randomisierte Studien. Die gerbsäurehaltigen Bärentraubenblätter lösen nicht selten Erbrechen und Übelkeit
aus, bei längerer Anwendung droht Hydrochinonvergiftung.17 Aufgrund methodischer Mängel der bislang vorliegenden Untersuchungen ist die
Anwendung von Bakterienextrakten (URO-VAXOM u.a.) nicht zu empfehlen (vgl. a-t 2 [1994], 19; 6 [1994], 54). Die beschwerdelindernde Wirkung populärer Spasmolytika wie Trospiumchlorid (SPASMEX
u.a.) ist nicht erwiesen.
Eine Patientin mit unkompliziertem Harnwegsinfekt soll über die Gutartigkeit der Erkrankung, über mögliche Rezidive und gegebenenfalls über
den Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr aufgeklärt werden. Was die übliche Empfehlung, mehr zu trinken (Cave: Herzinsuffizienz), tatsächlich
bringt, ist nicht erwiesen.5 Bei Schmerzen wird Wärme als krampflösend und angenehm empfunden.
REZIDIVIERENDE UNKOMPLIZIERTE HARNWEGSINFEKTE: Jede zehnte Frau mit Erstinfekt und jede zweite mit rezidivierenden Infekten erleiden
innerhalb eines Jahres eine weitere Episode. Als Rückfall gilt ein innerhalb von zwei Wochen wiederkehrender Infekt.1 Er wird auf Erreger
zurückgeführt, die trotz anfänglichem Therapieerfolg persistieren. Rückfälle sind mit weniger als 10% aller Rezidive eher selten. Behandelt
wird mit demselben Medikament (also meist Trimethoprim) über 10 Tage. Bei erneutem Rückfall ist eine Kultur anzulegen und sono- bzw. urographisch ein
Steinleiden oder eine Harnwegsanomalie auszuschließen.
Die mit über 90% weitaus häufigeren Rezidive nach mehr als zwei Wochen gelten als Neuinfektionen. Darm- und Vaginalflora bilden das
Erregerreservoir. Neuinfektionen werden wieder mit einer Kurzzeittherapie behandelt. Wechsel des Medikaments ist nicht erforderlich.
Häufige Neuinfektionen sollen einmal durch Urinkultur dokumentiert werden. Kommt es jährlich zu drei oder mehr Erkrankungen und besteht ein
zeitlicher Zusammenhang zum Geschlechtsverkehr, kann es hilfreich sein, unmittelbar danach 100 mg Trimethoprim einzunehmen. Geprüft ist ein Prophylaxe-
Regime mit Co-trimoxazol. In der plazebokontrollierten Studie sinkt die Infektrate von 3,6 auf 0,3 pro Frau und Jahr.18 Entgegen der üblichen
Empfehlung hat Wasserlassen nach dem Koitus in einer prospektiven Studie keinen Einfluss auf die Infekthäufigkeit.19
Fehlt ein Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr, kann eine Langzeitprophylaxe mit täglich 100 mg Trimethoprim für sechs Monate erwogen
werden.20 Junge Frauen mit häufigen unkomplizierten Infekten und guter Compliance können die Rezidivbehandlung auch jeweils selbst
einleiten (Vorabverordnung).21
Schädigung der Vaginalflora disponiert zu Harnwegsinfekten. Von Genital-"Hygiene" mit "Intimsprays" oder Scheidenspülungen, z.B.
mit Desinfektionsmitteln wie Polyvidonjod (BETAISODONA VAGINAL ANTISEPTIKUM u.a.), ist abzuraten. Auch Spermizide (a-t 3 [1998], 35) oder Scheidendiaphragmen scheinen wiederkehrende Infekte zu fördern. Kalte Füße
können bei Neigung zu Rezidiven eine akute Episode auslösen.22
Bei Frauen nach der Menopause bessert eine Estriol-haltige Vaginalcreme (OESTRO-GYNAEDRON M u.a.) das Keimmilieu der Schleimhaut von Vulva und
Vagina und mindert die Häufigkeit von Harnwegsinfekten.23 Der Nutzen systemischer Östrogene für diese Indikation bleibt zu klären.
Randomisierte Studien kommen zu widersprüchlichen Ergebnissen.24,25
Über epidemiologische Hinweise26 hinaus sind die klinischen Belege für eine vorbeugende Wirkung der auch in Laienmedien propagierten
nordamerikanischen Preiselbeeren (Cranberries) mager. In einer randomisierten Interventionsstudie nehmen Bakteriurien zwar ab.27 Die bislang
einzige kontrollierte Studie, in der der Schutz vor rezidivierenden Infekten geprüft wird, hat jedoch eine Drop-out-Rate von knapp 50% (9 Frauen) bei einer
ohnehin sehr kleinen Teilnehmerzahl von 19.28
In einer ersten kontrollierten Studie zur Rezidivprophylaxe mit Akupunktur29 werden Episoden mit akuten Beschwerden, bei denen die bakteriologische
Bestätigung fehlt, in der Ergebnisanalyse nicht berücksichtigt. Ob die Methode wirkt, bleibt daher offen.
KOMPLIZIERTE HARNWEGSINFEKTE: Für komplizierte Infekte (siehe Tabelle) werden längere Behandlungszyklen empfohlen: im Allgemeinen
7 bis 14 Tage. Mit Rezidiven ist besonders dann zu rechnen, wenn die Grunderkrankung nicht geheilt werden kann.
Grundsätzlich kommen alle für den einfachen Harnwegsinfekt verfügbaren Antibiotika auch für die Therapie komplizierter Infekte in Betracht
(Ausnahmen: Fosfomycin und Nitrofurantoin). Da die schweren Störwirkungen zum Teil dosisabhängig auftreten, dürfte Nitrofurantoin bei
Niereninsuffizienz und bei Älteren ohnehin nicht angewendet werden.
NIERENBECKENENTZÜNDUNG: Die unkomplizierte Pyelonephritis wird nach Anlegen einer Kultur 14 Tage lang antibiotisch behandelt.30
Mittel der Wahl für die empirische Therapie sind zweimal täglich 960 mg Co-trimoxazol. Studien zur Wirksamkeit von Trimethoprim allein fehlen.
Gyrasehemmer stehen in der Reserve. Patienten mit unkomplizierten Nierenbeckenentzündungen können ambulant behandelt werden, wenn der
Allgemeinzustand es zulässt. Für Schwangere und andere Personen mit komplizierter Pyelonephritis bei Urolithiasis, schwerer Niereninsuffizienz oder
Immunsuppression wird stationäre Aufnahme empfohlen.
ASYMPTOMATISCHE BAKTERIURIE: Bei 5% der erwachsenen Frauen unter 60 Jahren findet sich eine Bakteriurie, ohne dass Beschwerden vorliegen.
Ältere Menschen sind häufiger betroffen, demente, inkontinente Patienten bis zu 50%.15 Dauerkatheter verursachen innerhalb von 30 Tagen bei
fast allen eine Bakteriurie.31
Asymptomatische Bakteriurien sind nur bei Schwangeren, vor urologischen Eingriffen sowie bei Personen mit Harnwegsanomalien
behandlungsbedürftig.32,33 Schwangere erhalten vier bis sieben Tage lang dreimal täglich 500-750 mg Amoxicillin, alternativ ein
Cephalosporin.1 Unbehandelt erkrankt etwa jede dritte an Nierenbeckenentzündung.
In anderen Situationen, auch bei asymptomatischer Bakteriurie durch Dauerkatheter, senken Antibiotika weder die Rate symptomatischer Harnwegsinfekte noch die
Sterblichkeit, fördern aber eine Besiedlung mit resistenten Bakterien oder Pilzen.34-36 Bei symptomatischen Infekten ist wegen der Gefahr der
Urosepsis ein liegender Katheter zu entfernen.
URETHRITIS: Harnröhreninfekte werden meist durch Chlamydia trachomatis, Gonokokken oder Ureaplasma urealyticum verursacht, häufig
durch Mehrfachinfektionen. Sexualpartner sind meist ebenfalls infiziert und zu behandeln.
Patienten mit Chlamydien-Urethritis nehmen zweimal täglich 100 mg Doxycyclin (VIBRAMYCIN N u.a.) über sieben Tage oder einmalig 1.000 mg
Azithromyzin (ZITHROMAX; a-t 6 [1995], 59). Eine Gonorrhoe spricht auf einmalig 500 mg Ciprofloxacin (CIPROBAY
u.a.) per os oder 250 mg Ceftriaxon (ROCEPHIN) i.m. an.
FAZIT: Harnwegsinfekte betreffen vor allem junge, sexuell aktive Frauen. Rezidive kommen häufig vor. Über 90% der einfachen, meist E.-coli-
bedingten Infekte sprechen auf eine Dreitagesbehandlung mit Trimetho-
prim (TMP-RATIOPHARM) an. Bei Unverträglichkeit kommt Amoxicillin (AMOXYPEN u.a.) in Betracht. Für die akute Nierenbeckenentzündung ist
Co-trimoxazol (BACTRIM u.a.) über 14 Tage Mittel der Wahl. Gyrasehemmer haben Reservestatus.
Infekte bei Männern, Kindern, Schwangeren oder bei Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus gelten als kompliziert und werden mindestens sieben Tage lang
behandelt. Der Erreger ist durch Kultur zu sichern. Mit wenigen Ausnahmen erfordert die asymptomatische Bakteriurie keine Behandlung.
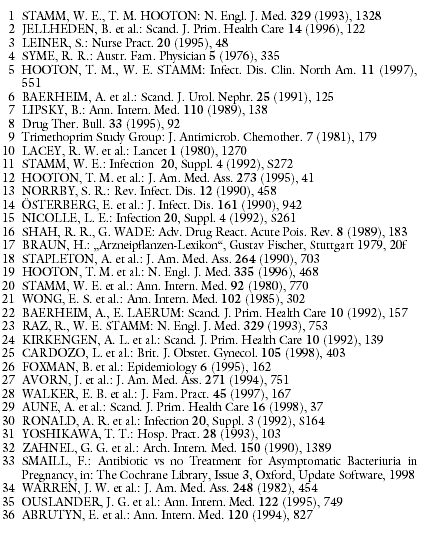
|