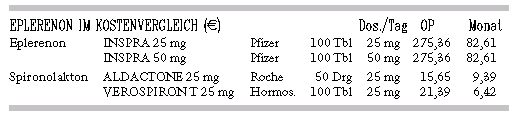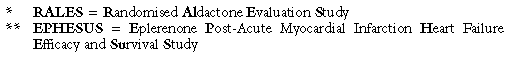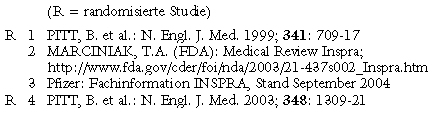Mit Veröffentlichung der RALES-Studie*1 etablierte sich die Therapie der schweren Herzinsuffizienz mit Spironolakton (ALDACTONE u.a.;
a-t 1999; Nr. 9: 95), obwohl der Aldosteronantagonist hierzulande in dieser Indikation nicht zugelassen ist. Jetzt kommt
mit  Eplerenon (INSPRA) ein analoger Wirkstoff zur Behandlung der Herzinsuffizienz nach
kürzlich aufgetretenem Herzinfarkt auf den Markt. Damit soll ein sehr breites, von Spironolakton abweichendes Anwendungsgebiet besetzt werden. In den USA
ist das Mittel zusätzlich zur Therapie der arteriellen Hypertonie zugelassen. Eplerenon (INSPRA) ein analoger Wirkstoff zur Behandlung der Herzinsuffizienz nach
kürzlich aufgetretenem Herzinfarkt auf den Markt. Damit soll ein sehr breites, von Spironolakton abweichendes Anwendungsgebiet besetzt werden. In den USA
ist das Mittel zusätzlich zur Therapie der arteriellen Hypertonie zugelassen.
EIGENSCHAFTEN: Das dem Spironolakton chemisch eng verwandte Eplerenon bindet selektiv an Mineralkortikoid-Rezeptoren, hemmt
kompetetiv die Aldosteron-Wirkung und die damit verbundenen Effekte auf Elektrolyte, Zellproliferation, Bildung von Kollagen, Gerinnung u.a. Die Bindung scheint
selektiver, die Hemmwirkung jedoch schwächer als die von Spironolakton zu sein.2
Maximale Plasmakonzentrationen werden zwei Stunden nach Einnahme erreicht. Eplerenon wird durch das Cytochrom-P450-Isoenzym CYP 3A4 verstoffwechselt.
Die gleichzeitige Einnahme starker CYP-3A4-Hemmstoffe wie Ketoconazol (NIZORAL) und Itraconazol (SEMPERA u.a.) ist kontraindiziert.3
WIRKSAMKEIT: In der für die Zulassung relevanten EPHESUS-Studie** nehmen 6.632 Patienten nach akutem Herzinfarkt in den
zurückliegenden zwei Wochen und mit eingeschränkter Linksherzleistung (Auswurffraktion unter 40% und klinische Zeichen der Lungenstauung oder
Nachweis eines dritten Herztones) entweder 25 mg bis 50 mg Eplerenon oder Plazebo ein.4 Die Dosierung wird je nach Höhe des Kaliumspiegels
angepasst. Als Basisbehandlung nehmen unter anderem 86% ACE-Hemmer oder Angiotensin-II-Blocker und 75% Betablocker ein. Diabetiker werden auch ohne
Vorliegen einer klinischen Herzinsuffizienz in die Studie aufgenommen. Nach durchschnittlich 16 Monaten sind unter Eplerenon 14,4%, unter Plazebo 16,7%
verstorben (primärer Endpunkt; Number needed to treat = 44).4 Der Nutzen kommt vor allem in den ersten 30 Tagen zustande, hauptsächlich
durch Verringerung plötzlicher Herztode. Ein Zusammenhang mit dem Einfluss auf den Kaliumspiegel wird vermutet, da vor allem Patienten mit niedrigen
Ausgangswerten profitieren.2 Die Herzinsuffizienz wird hingegen nicht eindeutig gebessert. Patienten über 75 Jahre profitieren ebenso wenig wie
solche mit Diabetes mellitus ohne klinische Linksherzinsuffizienz und Patienten mit einer Auswurffraktion von mindestens 35%.
Ein zweiter primärer Endpunkt, Eintreten von kardiovaskulärem Tod oder Krankenhausaufnahme aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, wird erst kurz
vor Beendigung der Studie eingeführt, nachdem Zwischenanalysen vorlagen. Ein Hinweis auf diese inadäquate Vorgehensweise fehlt in der Publikation.
Ein signifikanter Unterschied zu Plazebo kommt bei diesem Endpunkt zudem nur durch willkürliches Ausklammern bestimmter kardialer Komplikationen
zustande.2
Eine nicht veröffentlichte Auswertung der Lebensqualität lässt keinen Vorteil zugunsten von Eplerenon erkennen.1
Optimale Dosierung und Anwendungsdauer sind unklar. Direkte Vergleiche mit dem nur bei schwerer chronischer Herzinsuffizienz (NYHA IV) geprüften
Spironolakton liegen nicht vor.
STÖRWIRKUNGEN: Schwere Hyperkaliämien über 6 mmol/l treten unter Eplerenon bei 5,5%, unter Plazebo bei 3,9% der Patienten auf. Die
Gefährdung nimmt bei Verschlechterung der Nierenfunktion zu. Nach Erfahrungen mit Spironolakton ist das Risiko bei Einnahme außerhalb von
Studienbedingungen wahrscheinlich deutlich höher, da Kontraindikationen oftmals missachtet und Kontrollen seltener durchgeführt werden (vgl. Seite 142). Schwere Hypokaliämien kommen in EPHESUS unter Eplerenon seltener vor als unter Plazebo (8,4% versus 13,1%).
Gynäkomastie ist in beiden Gruppen gleich häufig (0,5% versus 0,6%), wird jedoch nicht gezielt abgefragt.2 Drei Patientinnen entwickeln unter
Eplerenon ein Mammakarzinom (unter Plazebo keine). Andererseits wird bei neun Männern unter Plazebo ein Prostatakarzinom festgestellt, hingegen nur bei
einem unter Eplerenon. Diese Differenzen können auf einen östrogenartigen Effekt von Eplerenon hindeuten. Die Häufung von Mammakarzinomen
wird im Bewertungsbericht der amerikanischen Zulassungsbehörde als bedenklich angesehen, vor allem bei der Behandlung von Patientinnen mit arterieller
Hypertonie.2
KOSTEN: Im Vergleich zur Behandlung der schweren Herzinsuffizienz mit täglich 25 mg Spironolakton (ALDACTONE: 9,39 –€/Monat,
VEROSPIRON T: 6,42 €) ist für Eplerenon (INSPRA) mit 82,60 €/Monat (identischer Preis für 25 mg und 50 mg) das 9- bis 13fache
aufzuwenden.
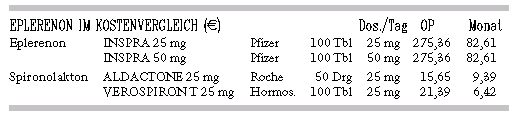
 Der neue Aldosteronantagonist Der neue Aldosteronantagonist  Eplerenon (INSPRA) senkt in einer Studie die Sterblichkeit bei Patienten mit Zeichen der Linksherzinsuffizienz nach
kürzlich durchgemachtem Herzinfarkt vor allem durch Verringerung akuter Todesfälle. Ein Einfluss auf den Verlauf der Herzinsuffizienz ist hingegen nicht
eindeutig belegt. Eplerenon (INSPRA) senkt in einer Studie die Sterblichkeit bei Patienten mit Zeichen der Linksherzinsuffizienz nach
kürzlich durchgemachtem Herzinfarkt vor allem durch Verringerung akuter Todesfälle. Ein Einfluss auf den Verlauf der Herzinsuffizienz ist hingegen nicht
eindeutig belegt.
 Patienten über 75 Jahre, solche mit einer Auswurffraktion von mindestens 35%
und Diabetiker ohne klinische Zeichen einer Herzinsuffizienz profitieren nicht. Patienten über 75 Jahre, solche mit einer Auswurffraktion von mindestens 35%
und Diabetiker ohne klinische Zeichen einer Herzinsuffizienz profitieren nicht.
 Mit schweren Hyperkaliämien ist zu rechnen. Mit schweren Hyperkaliämien ist zu rechnen.
 Die Häufigkeit hormonaler Störwirkungen wie Mastopathie ist nicht
hinreichend geklärt. Mammakarzinome geben zu Bedenken Anlass. Die Häufigkeit hormonaler Störwirkungen wie Mastopathie ist nicht
hinreichend geklärt. Mammakarzinome geben zu Bedenken Anlass.
 Vor einer breiten Anwendung des wenig erprobten Aldosteronantagonisten in dem
weit formulierten Anwendungsgebiet müssen weitere Studien den Nutzen bestätigen und offene Fragen wie Behandlungsdauer und sicher profitierende
Subgruppen geklärt werden. Vor einer breiten Anwendung des wenig erprobten Aldosteronantagonisten in dem
weit formulierten Anwendungsgebiet müssen weitere Studien den Nutzen bestätigen und offene Fragen wie Behandlungsdauer und sicher profitierende
Subgruppen geklärt werden.
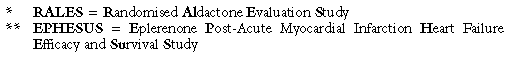
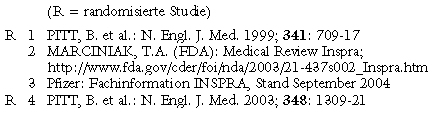
|