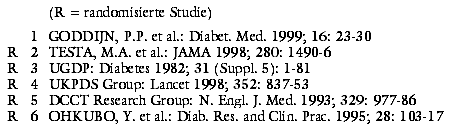Die Blutzuckersenkung bei Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus soll Hyperglykämiesymptome mindern und das Risiko der Folgekomplikationen
senken. Hyperglykämie-bedingte Beschwerden wie Abgeschlagenheit, Polyurie und Durst treten nahezu ausschließlich bei Patienten mit Glukosurie auf.
Senkung des HbA1c-Wertes in den Bereich um 8% kann diese Beschwerden wirksam reduzieren.1,2 Ein HbA1c-Wert um 8%
entspricht in etwa präprandialen Blutzuckerwerten um 180 mg/dl bzw. dem Verschwinden von Zucker aus dem Urin.1,2 Für die Selbstkontrolle
bei diesem Therapieziel reicht es daher aus, den Urinzucker zu messen (a-t 1997; Nr.10: 107 und 2001; 32: 46-7).
Die seit Jahrzehnten brennende Frage der Diabetologie ist, ob sich die hohe Morbidität und Mortalität der Patienten mit Typ-2-Diabetes durch Senkung
des Blutzuckers in einen nahezu normoglykämischen Bereich (HbA1c um 6% bis 7%) reduzieren lassen. Mit dieser Frage haben sich bislang nur
zwei randomisierte Langzeitstudien beschäftigt, die UGDP* (a-t 1997; Nr. 4: 41-3) und die UKPDS* (a-t 1998; Nr. 10: 88-90).3,4 Leider ist es in keiner dieser Studien gelungen, durch bessere Blutzuckerkontrolle die
Sterblichkeit oder die Häufigkeit von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Amputationen, Erblindungen oder Dialysen zu senken (siehe Tabelle auf Seite 18). Statistisch signifikant werden in der UKPDS nur Surrogatparameter beeinflusst: Unter der intensiven Therapie sinkt
innerhalb von zehn Jahren das Risiko einer Retina-Laserkoagulation um absolute 2,8% (NNTJahr = 357) und das Risiko einer Verdoppelung des
Serumkreatinins um 1,05% (NNTJahr = 952). Wie an der großen Zahl der dafür zu behandelnden Patienten (Number Needed to Treat [NNT],
vgl. a-t 1998; Nr. 5: 47-50) deutlich wird, ist selbst dieser Effekt relativ gering. Senkung des Blutzuckers in
normoglykämische Bereiche steigert aber bei älteren Patienten das Risiko schwerer Unterzuckerungen erheblich.4
Für die kleine Minderheit junger Patienten mit Typ-2-Diabetes, die wegen ihrer langen Lebenserwartung ein hohes Risiko haben, mikroangiopathische
Spätschäden zu erleiden, erscheint es sinnvoll, in Anlehnung an die DCCT*5 (a-t 1993; Nr. 8: 78)
Therapieziele wie beim Typ-1-Diabetes mellitus anzustreben, also nahezu normalisierte Blutzuckerwerte. Dieses Vorgehen wird auch durch eine japanische Studie
zur intensivierten Insulintherapie bei jüngeren Patienten mit Typ-2-Diabetes gestützt.6 An dieser Studie haben überwiegend schlanke
Patienten teilgenommen, deren Diabetes mellitus durchschnittlich im Alter von Anfang bis Mitte 40 manifest wurde.6 Dagegen sind die Patienten der UKPDS
eher übergewichtig und durchschnittlich Mitte 50 bei Diagnose ihres Diabetes.4 Um das Ziel der Normoglykämie zu erreichen, ist eine
adäquate Schulung in der Anwendung einer flexiblen Insulintherapie notwendig, bei der die Patienten auch lernen, die Insulindosierung selbstständig auf
Grund selbstgemessener Blutzuckerwerte anzupassen.

Für die überwiegende Zahl der älteren Patienten mit Typ-2-Diabetes lässt sich aus bisherigen Studien kein relevanter Nutzen der
straffen Blutzuckereinstellung ableiten. Hier reicht daher das Therapieziel, Hyperglykämie-bedingten Beschwerden vorzubeugen, und somit die
Urinzuckerkontrolle. Eine Anpassung der Insulindosis auf der Basis von Blutzuckerselbstmessungen ist hier nicht erforderlich.
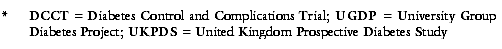
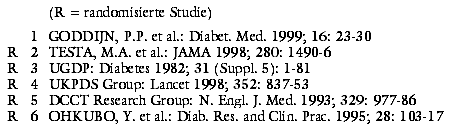
|